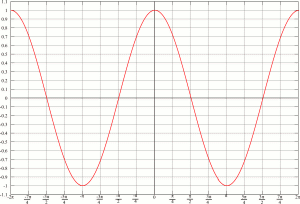Honig ist ein wertvolles Nahrungsmittel, das von manchen Menschen sogar als Arzneimittel, ja teilweise als wahres Wundermittel gegen tausend und ein Zipperlein gepriesen wird. Auf jeden Fall ist er, wenn er vom heimischen Imker stammt, ein naturbelassenens Lebensmittel, dessen Produktion, die Imkerei, ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems ist: Mehr als ein Drittel unserer Kulturpflanzen kommt mit dem WInd als (alleinigem) Bestäuber nicht aus, sondern benötigt Insekten dazu. Hier spielt die Bienenhaltung eine wichtige Rolle.

Honig - eine Leckerei, die nicht nur die Zähne nicht angreift, sondern auch gut für das Zahnfleih ist (Bild: United States Department of Agriculture, PD)
Ein Wundermittel?
In den meisten Fällen lassen sich die unglaublichen Heilwirkungen, die so manchem einfachen Mittel aus der Natur von Enthuasiasten zugeschrieben wird, nicht wissenschaftlich einwandfrei beweisen, wobei man sich dabei natürlich im klaren sein muss, dass Schulmedizin und Pharmalobby kein Interesse daran haben, die Wirksamkeit von preisgünstigen Naturheilmitteln zu bestätigen. Doch selbst das, was sich wissenschaftlich nachweisen lässt - böse Zungen mögen behaupten: von der Schulmedizin widerwillig zugegeben wird ;-) - ist in vielen Fällen erstaunlich. Und genau das ist auch beim Honig der Fall.
Selbst eine zumindest im Anklang eher kritische Arbeit eines Arztes vom Universitätsklinikum Gießen bescheinigt dem Honig eine ganze Reihe von heilsamen Wirkungen: Von einer nachweislichen antibakteriellen und die Wundheilung fördernden Wirkung ist da unter anderem die Rede, von positiver Wirkung bei bestimmten Hauterkrankungen und von günstigem EInfluss auf Blutfettwerte. Weiterhin erfährt man, dass Honig keine Karies verursacht und gleichzeitig gegen Paradontose wirkt. Es scheint also tatsächlich einiges dran zu sein an den Geschichten die man über die Wirkungen des Bienenproduktes hört und auf jeden Fall ist der Honig ein gesundes, nahrhaftes und leckeres Lebensmittel.
Das kleinste Nutztier
Sieht man einmal von Einzellern wie dem Essigsäurebakterium ab, dürfte die Honigbiene das wohl kleinste Nutztier sein, welches der Mensch hält. An sich ist die Imkerei ein sehr altes Handwerk, welches schon bei den Kulturvölkern der Antike bekannt war. Anhand gefundener Beuten, so nennt der Imker künstliche Bienenwohnungen und einschlägigen Darstellungen, konnten Archäologen nachweisen, dass bereits die alten Ägypter und sogar die Mesopotamier die Bienenzucht kannten. Offenbar ist diese Kunst aber später wieder zumindest teilweise in Vergessenheit geraten: Im Mittelalter begegnen uns nämlich anstatt der heutigen Imker zunächst die Zeidler als Honiglieferanten.

Der Zeidler war noch kein Imker im heutigen Sinne, denn er sammelte wilden Honig und schuf den Bienen lediglich Nistgelegenheiten, in denen sie sich von selbst ansiedelten, züchtete also nicht.
Die Arbeit der Zeidler bestand darin, im Wald nach Nestern von wild lebenden Biene zu suchen und diese ausszuräubern. Außerdem schufen sie auch künstliche Nistgelegenheiten für die wilden Bienen in Bäumen. Honig war, abgesehen von dem ab ca. 1100 n.Chr. bei uns bekannten und damals immens teuren Rohrzucker, praktisch das einzige Süßungsmittel. Da auch Bienenwachs in großen Mengen, vor allem auch von der Kirche nachgefragt wurde, waren die Zeidler eine hoch angesehene Zunft. SIe hatten erhebliche Privilegien und durften sogar bewaffnet in den Wald gehen.

In der Lünebürger Heide wird auch heute noch ein wenig Korbimkerei betrieben, wobei das Heidekraut als Bienenweide dient
(Dieses Bild basiert auf dem Bild Lüneburger Heide 110.jpg aus der freien Mediendatenbank Wikimedia Commons und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Der Urheber des Bildes ist Willow)
Neben der Zeidlerei entwickelt sich auch die Korbimkerei, ab dem 14. Jahrhundert lassen sich neben den Zeidlern auch schon Imkerzünfte nachweisen. Man imkerte damals mit Bienenkörben; die Honigernte bedeutete auch das Ende des Bienvolkes. Da man ja keinen billigen Zucker als Austausch für den Honig hatte, konnte man die abgeernteten Völker nicht über den Winter bringen. Daher spielte es auch keine Rolle, dass mit der Honigernte auch das Bienennest im Korb zerstört wurde.
Diese Art der Imkerei findet man heute noch in der Lüneburge Heide. Sie bedingt, dass der Imker sein Völker im Frühsommer durch Schwärmen vermehrt; er hat also jedes Jahr neue Bienenvölker. Dass sich diese recht wenig produktive Art der Imkerei noch einigermaßen halten konnte, liegt wohl daran, dass die Heideblüte erst im Spätsommer/Frühherbst stattfindet, wenn die anderen Imker das Bienenjahr bereits beenden. Die Bienenvölker der Heideimker haben daher länger Zeit, stark genug zu werdem um lohnenden Mengen Honig zu sammeln.
Moderne Imkerei
Seitdem Zucker billig verfügbar ist, kann man den Bienen diesen als Ersatz für den entnommenen Honig geben. Außerdem braucht man Beuten, aus denen man den Honig entnehmen kann, ohne das Bienenvolk zu zerstören. Das funktioniert, weil die Bienen Honig und Brut einigermaßen getrennt halten und man so die Waben mit dem Honig entnehmen kann, ohne die Brut zu beschädigen. Da bei dieser Art zu Imkern, die Bienenvölker bereits mit voller Stärke in das Frühjahr starten, kann man (wenn alles gut geht) bereits im Juni das erste Mal Honig ernten, der dann aus dem Nektar von Blütenpflanzen gemacht ist und Blütenhonig heißt. Mehr oder weniger sortenreine Honige erreicht der Imker, in dem er seine Bienen in der jeweiligen Blütezeit zu großen Beständen einer Blütenpflanze bringt, z.B. an einen Rapsacker oder in ein Obstbaugebiet. Diese Technik bezeichnen die Imker als Wandern.

Heutzutage lässt man die Bienen ihre Waben in spezielle Rahmen bauen und erhält so ein "zerlegbares" Bienennest
Wenn die Hauptblütezeit im Frühjahr vorbei ist, beginnen die Bienen den Honigtau von Bäumen zu sammeln, das sind die stark zuckerhaltigen Ausscheidungen der Blattläuse. Daraus wird dann der Waldhonig, der im Hoch- oder Spätsommer geernte wird. Das Angebot an Honigtau schwankt von Jahr zu Jahr und damit auch das Angebot an Waldhonig, so wie das Aufkommen des Blütenhonigs mit den Bedingungen für die Blütenentwicklung steht und fällt.
Im Spätsommer oder Frühherbst füttert man die Bienen dann mit Zuckerwasser. Auch aus diesem können sie eine Art Honig machen, mit dem sie dann über den Winter kommen.
Bienenzucht, Landwirtschaft und Ökosystem
Die Honigbiene ist ein wichtiger Bestäuber für einen großen Teil unserer Kulturpflanzen. Das war früher kein Problem, da die Bienenhaltung eigentlich zu jeder Landwirtschaft gehörte. Mittlerweile sind Imker jedoch rar geworden, so dass Bauern es meist gerne erlauben, dass Imker ihre Beuten an Ihre Obstwiesen stellen oder ihre Rapsäcker anwandern. Gerade auch für die ökologisch wertvollen Streuobstwiesen sind Bienen wichtig, man kann durchaus sagen : Wer A(pfelsaft aus heimischer Produktion) trinken will, muss also auch B(ienenhonig vom lokalen Imker) essen. Auch für die Blütenpflanzen der ebenfalls wichtigen Feldhecken dürfte die Biene eine große Rolle spielen.

Die Honigbiene ist ein wichtiger Bestäuber der Obstbäume und hilft daher den ökologisch wichtigen Streuobstwiesen
Mangelware kann die Bestäubungsleistung der Bienen aber auch in Wohngebieten mit Nutzgärten sein. Leider muss durch die übertriebene Angst vor Bienenstichen der Hobbyimker hier vielerorts mit Gegenwind rechnen, obwohl die Bienenhaltung - zumindest im kleinen, nichtgewerblichen Rahmen - auch im Garten möglich und zulässig ist. Wer über Nachbars Bienen meckert und sich damit durchsetzt, braucht sich also nachher nicht zu wundern, wenn seine gehätschelten Obstbäume nicht mehr so schön tragen wie vorher.
Vor allem aber sollte man seinen Honig vom örtlichen Imker kaufen. Dort ist er auch nicht nennenswert teurer als im Supermarkt und man weiß, dass man heimische Qualität hat - und nicht irgendetwas aus Argentinien, Mexiko, Brasilien oder gar Indien. Vo allem aber hilft man dabei unserer heimischen Kulturlandschaft.